|
Bayern
sei Dank: EnEV-Novelle nun doch auf der Tagesordnung des
Bundesrat-Plenums am 5. Juli 2013
Die Politik ist immer für eine Überraschung
gut: Im letzten Newsletter berichteten wir
noch, dass
die Diskussion zur EnEV-Novelle von der
Tagesordnung des Bundesrats-Plenums gestrichen
wurde. Nun hat der Freistaat Bayern durch einen
Aufsetzungsantrag dafür gesorgt, dass das
Thema
wieder auf der Tagesordnung erscheint - zwar als Top
84 - sowie auch beantragt "eine
sofortige Sachentscheidung herbeizuführen". Die
zuständigen Fachausschüsse – mit Ausnahme des
Umweltausschusses – haben inzwischen ihre "Hausaufgaben"
gemacht und eine Empfehlung für die Plenarsitzung
ausgearbeitet (Bundesrats
Drucksache 113/1/13). Wird die EnEV-Novelle doch
noch vor der
Bundestagswahl verabschiedet?
Wie
lautet der aktuelle Stand?
Was empfehlen die
Bundesrats-Ausschüsse zur EnEV Novelle?
Wann wird die EnEV-Novelle fertig sein?

Das
Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) wurde
inzwischen vom Bundestag verabschiedet und der Bundesrat
hat sich nicht dagegen verwehrt. Er hätte auch den
Vermittlungsausschuss aufrufen können. Dieses ist nicht
passiert und somit hat der Bundesrat auch indirekt dem
geänderten Gesetz zugestimmt, obwohl seine Empfehlungen
weitestgehend unbeachtet blieben.
Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) ermächtigt die
Bundesregierung, dass sie Rechtsverordnungen -
wie die Energieeinsparverordnung - erlässt, die dazu
führen, dass wir im Gebäudebereich Energie einsparen.
Allerdings hat der Bundesrat bei der Novellierung der
Energieeinsparverordnung (EnEV) laut EnEG ein
entscheidendes Wort mitzureden. Nur mit seiner
Zustimmung kann die Bundesregierung solche Verordnungen
erlassen oder ändern, wie jetzt die EnEV-Novelle. Im
Bundesrat sitzen die Vertreter der Bundesländer und in
den Fachausschüssen ihre Spezialisten für die
verschiedenen Fachgebiete. Dies ist verständlich, denn
sie verantwortet letztendlich auch wie die EnEV in der Praxis
umgesetzt wird.
Laut jetzigem Stand ist das Thema EnEV-Novelle auf dem
Tagungsprogramm der Plenarsitzung des Bundesrates vom
Freitag, den 5. Juli 2013 als Top 84. Als Ausgangspunkt zur
Diskussion dienen der Kabinetts-Beschluss der
Bundesregierung zur EnEV-Novelle von Anfang Februar 2013
(Bundesrats-Drucksache 113/13) sowie die Empfehlung der
Ausschüsse vom 28 Juni 2013
(Bundesrats-Drucksache113/1/13).

Der Umweltausschuss
(Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit) hat das Thema „EnEV-Novelle“ auf den
Herbst vertagt. In den Empfehlungen der anderen
zuständigen Ausschüsse, an
denen sich die Mitglieder des Bundesrates in der
kommenden Plenarsitzung orientieren können, ist
vermerkt, dass der Umweltausschuss seine Beratungen zu
der Vorlage noch nicht abgeschlossen hätte. Die Fußnote
zu dieser Bemerkung zeigt jedoch, dass der Bundesrat
durchaus auch eine Entscheidung treffen kann, wenn der
Umweltausschuss dazu noch nicht beraten hat: „… der
Freistaat Bayern hat beim Präsidenten des Bundesrates
beantragt, die Vorlage auf die Tagesordnung der 912.
Sitzung des Bundesrates am 5. Juli 2013 zu setzen und
eine sofortige Sachentscheidung herbeizuführen.“ Das
Land Bayern ist offensichtlich entschlossen „Nägel mit
Köpfen“ zu machen.
Der Finanzausschuss empfiehlt dem
Bundesrats-Plenum dem Kabinettsentwurf der
Bundesregierung zur EnEV-Novelle unverändert zuzustimmen
gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes. Hier ein
Auszug aus dem entsprechenden Text des Grundgesetzes:
„(2) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen,
vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher Regelung,
… Rechtsverordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die
der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ….“. Das
geänderte Energieeinsparungsgesetz (EnEG) ermächtigt die
Bundesregierung, auch dass sie die
Energieeinsparverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
ändert. Mit anderen Worten: der Bundestag kann hier
direkt kein Veto einlegen. Indirekt haben allerdings
seit
Mai dieses Jahres die überraschenden Bedenken der FDP-Fraktion
im
Bundestag zur Verschärfung des Energiestandards für
Neubauten sowie die daraus entsprungene Diskussion dazu
geführt, dass der Novellierungsprozess des EnEG und
dadurch auch der EnEV verzögert wurde. Auch die
Bundesratsausschüsse für Bau und Wirtschaft
empfehlen empfehlen die geplanten Anhebung des Energiestandards
für Neubauten zu reduzieren und auf eine einzige Stufe zu
beschränken.

Der federführende Bauausschuss (für Städtebau,
Wohnungswesen und Raumordnung) empfiehlt zusammen mit
dem Wirtschaftsausschuss zahlreiche Änderungen
des Kabinetts-Beschlusses zur EnEV-Novelle. Wir haben
für Sie die wichtigsten Aspekte hier zusammengefasst:
NEUBAU:
Der
Kabinettsentwurf der Bundesregierung sieht eine
zweistufige Verschärfung des Energiestandards
für Neubauten vor: mit Inkrafttreten der Novelle
und danach ab dem Jahr 2016. Dabei soll der
höchstzulässige Jahres-Primärenergiebedarf um
jeweils 12,5 Prozent sinken und der maximal
erlaubte Wärmeverlust durch die Gebäudehülle
parallel dazu sich um jeweils 10 Prozent mindern.
Die
beiden Ausschüsse schlagen eine moderatere
Verschärfung des Energiestandards für Neubauten
erst ab 1. Januar 2016 vor. Die Ausschüsse sehen
keinen fachlichen Grund für die geplante
Anhebung in zwei Stufen. Auch hätte die Praxis
gezeigt, dass bei zu zeitnahen Änderungen der
EnEV-Anforderungen es zu Schwierigkeiten im
Vollzug komme. Die Bundesregierung begründe die
geplante Anhebung auf den
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur
Fortschreibung der Energieeinsparverordnung, die
Professor Hauser und andere Experten
durchgeführt hätten. Für den Wohnungsneubau mit
der Referenztechnik „Brennwert + Solar“ hätten
die Gutachter für die zweite Stufe der Anhebung
der primärenergetischen Anforderungen mit
Amortisationszeiträumen je nach Haustyp zwischen
32,6 und 150,5 Jahren gerechnet kritisieren die
Bundesrats-Ausschüsse. Dieses sei im Sinne des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) nicht mehr
wirtschaftlich vertretbar. Deshalb lehnen die
Ausschüsse in ihrer Empfehlung die zweite Stufe
der energetischen Verschärfung sowohl für den
Primärenergiebedarf als auch für die den
Wärmeschutz der Gebäudehülle ab und zwar sowohl
für Wohn- als auch für Nichtwohngebäude. Sie
argumentieren, dass die Aufschiebung der
Verschärfung bis zum Jahr 2016 auch für das
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) die
Möglichkeit eröffne es bis dahin passend zu
novellieren.

Dieses empfehlen
die Bundesratsausschüsse für Gebäudezonen, die
durch dezentrale Gebläse- oder Strahlungsheizung
beheizt werden. Für sie sollte sich die
Anforderung an den Wärmeschutz der Gebäudehülle
im Vergleich zur EnEV 2009 nicht verschärfen. Es
handelt sich dabei beispielsweise um
Sporthallen, Handels- und Logistikgebäude.
Untersuchungen hätten gezeigt, dass in der
Baupraxis durch eine dezentrale Strahlung oder
Gebläseheizung der Spielraum für eine
wirtschaftlich noch höhere Wärmedämmung der
Außenhülle nicht gegeben sei. Dazu käme noch,
dass in solchen Fällen die Anforderungen des
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
meist mangels anderer Alternativen durch die
Ersatzmaßnahme (noch energieeffizienter bauen
als es die EnEV fordert) erfüllt wird. Eine
nochmalige Erhöhung des Wärmeschutzes über das
Niveau der jetzigen EnEV-Novelle wäre sicherlich nicht
mehr wirtschaftlich zu vertreten. Damit man
künftig aufwendige Antragsverfahren auf
Befreiung von den EnEV-Pflichten für diese
Gebäudezonen vermeide empfehlen die Ausschüsse
den Wärmeschutz der Gebäudehülle auf dem
Standard der EnEV 2009 zu belassen.

Tageslichtabhängige
Kontrolle im Referenzgebäude präzisieren
Die Neufassung der
Normenreihe DIN V 18599 (Energetische Bewertung
von Gebäuden), Ausgabe Dezember 2911, sieht im Teil 4 (Nutz- und
Endenergiebedarf für Beleuchtung) im Abschnitt
5.5.4 verschiedene Ausführungen für die
„tageslichtabhängige Kontrolle“ der Beleuchtung
im Gebäude vor. Die Ausschüsse empfehlen die
Referenzausführung in der Anlage 2 (Anforderungen
an Nichtwohngebäude) der EnEV-Novelle auch dahingehend zu
verändern, dass passende Kontrollarten angegeben
sind wie „gedämmt, nicht ausschaltend“, auch
wenn die Wirkung auf die Anforderungen an das
gesamte Gebäude bei den meisten Nutzungsarten
nicht ausschlaggebend sei.

Beim Endenergiebedarf
solare Strahlungsenergie, Umgebungswärme und
Umgebungskälte nicht berücksichtigen
Die Fachausschüsse
des Bundesrates schlagen vor, die hergebrachte
Bilanzierungsweise nach DIN V4701 (Energetische
Bewertung heiz- und raumlufttechnischer
Anlagen), Teil 10 (Heizung,
Trinkwassererwärmung, Lüftung) auch bei der
Berechnung nach der neuen Norm DIN V 18599
(Energetische Bewertung von Gebäuden), Teil 1
(Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe,
Zonierung und Bewertung der Energieträger),
Ausgabe Dezember 2011, anzuwenden. Bei der
Berechnung des Endenergiebedarfs sollten
diejenigen Anteile gleich Null gesetzt werden,
die durch folgende Quellen gedeckt werden: in
unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum
Gebäude gewonnene solare Strahlungsenergie,
Umgebungswärme und Umgebungskälte.
Die Ausschüsse versprechen sich davon, dass die
Berechnungsverfahren einheitlicher werden und
die Informationen im Energieausweis und in den
Pflichtangaben in Immobilienanzeigen auch
transparenter werden. Dies sei insbesondere
sinnvoll weil die neue EU-Gebäuderichtlinie 2010 verlange, dass in
Immobilienanzeigen der Endenergiebedarf oder
-verbrauch angegeben werde um einen
Vergleich der Heizkosten verschiedener
Immobilienangebote zu ermöglichen. Für den
Primärenergiebedarf als Gesamtergebnis der
Berechnung sei diese Festlegung ohne Belang,
begründen die Fachausschüsse, weil die
betreffenden Anteile ohnehin in beiden Verfahren
mit dem Primärenergiefaktor „Null“ bewertet
werden. Auch würde es die Berechnung des Wärme-
und Kälteenergiebedarfs nach dem EEWärmeG nicht
beeinflussen, weil es sich in diesem Fall nicht
um den Endenergiebedarf sondern um den in der DIN V
18599 als „Erzeugernutzwärmeabgabe“ bzw.
„Erzeugernutzkälteabgabe“ bezeichnete Wärme-
bzw. Kälteenergiebedarf handele. Durch diese
Änderung würde man auch vermeiden, dass die
Angabe des Endenergiebedarfs systematisch von
der Angabe des Endenergieverbrauchs abweicht.

BAUBESTAND:
Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen
regeln
Diese Empfehlung
werden sowohl Planer als auch Sachbearbeiter in
den Bauämtern begrüßen: Die aktuell geltende
EnEV 2009 erlaubt in den drei Paragraphen -
§ 10 (Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden), §
24 (Ausnahmen) und § 25 (Befreiungen), dass in
bestimmten Fällen Bauherrn oder Eigentümer die
EnEV-Anforderungen nicht erfüllen müssen, wenn
sie zu unwirtschaftlichen Lösungen führen und
die Verpflichteten überfordern. Die Verordnung
regelt jedoch nicht wie man die
Wirtschaftlichkeit einer Energiesparmaßnahme
berechnet und beurteilt.
Dieses führe nicht nur
unter Auftraggebern und Planern sondern auch
unter den Sachbearbeitern in den Bauämtern, die
gegebenenfalls entscheiden müssen, zu
Verwirrungen bemängeln die Experten in den
beiden Fachausschüssen. Deshalb empehlen sie, dass die
Bundesregierung federführend Maßstäbe zur
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen erarbeitet und
veröffentlicht.

Berechnungsmethode für
„unbillige Härtefälle“ festlegen
Der § 25
(Befreiungen) der EnEV 2009 erlaubt den Baubehörden,
dass sie verpflichtete Eigentümer von den
Anforderungen der Verordnung zu befreien, wenn
sie einen Antrag einreichen und ihn auch
entsprechend begründen. Wer beispielsweise seine
Nachrüstpflichten nicht erfüllen kann weil er
dafür Maßnahmen durchführen müsste, die zu einem
„angemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu
einer unbilligen Härte führen.“ kann auf Antrag
befreit werden. Was eine „unbillige Härte“
letztendlich bedeutet erklärt die EnEV 2009 damit,
dass die erforderlichen Kosten sich nicht
innerhalb der üblichen Nutzungsdauer - oder bei
Altbauten innerhalb einer angemessenen Frist –
amortisieren würden. Mit anderen Worten: Die
Energieeinsparungen durch Nachrüst-Maßnahmen
können das investierte Kapital nicht decken. Als
Beispiel einer unbilligen Härte führt die
EnEV 2009 im zweiten Absatz dieses Paragraphen
den hypothetischen Fall auf, dass ein Eigentümer
gleichzeitig mehrere Nachrüstpflichten gemäß
öffentlicher Vorschriften erfüllen muss.
Die
Bundesratsausschüsse empfehlen diese letzte
Erläuterung im zweiten Absatz gänzlich zu
streichen und eine verbindliche
Berechnungsmethode mit aufzunehmen um die
Unsicherheiten die sich aus dem rechnerischen
Beweise ergeben
zu beenden. Deshalb schlagen sie vor,
dem ersten Absatz dieses Paragraphen einen Satz
hinzuzufügen indem drei Berechnungsmethoden als
anerkannte Optionen angegeben werden für den
Nachweis und die Entscheidung ob es sich um eine
unbillige Härte handelt:
-
EU-Verordnung
vom 16. Januar 2012 als Ergänzung zur
EU-Gebäuderichtlinie 2010 für „die Schaffung
eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur
Berechnung kostenoptimaler Niveaus von
Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und
Gebäudekomponenten;
-
VDI-
Richtlinie 2067 Blatt 1 (Wirtschaftlichkeit
gebäudetechnischer Anlagen) vom September
2012 veröffentlicht im Beuth Verlag;
-
VDI-
Richtlinie 6025 (Betriebswirtschaftliche
Berechnungen für Investitionsgüter und
Anlagen) vom November 2011 veröffentlicht im
Beuth Verlag.
Interessant ist
der Hinweis in der Empfehlung der Ausschüsse,
dass bislang kein einziger Fall bekannt sei in
dem ein EnEV-Verpflichteter befreit worden wäre
weil er parallel mehreren öffentlich-rechtlichen
Pflichten nachkommen müsse und dieses zu einer
unbilligen Härte führen würde.

Für Anbauten und
Umbauten die EnEV-Nachweisführung ändern
Wer heute einen
Anbau oder Umbau plant und dabei die beheizte
oder gekühlte Nutzfläche mehr als 15 m²
erweitert, muss die EnEV 2009 entsprechend beachten.
Dabei spielt es eine Rolle, ob diese Fläche
kleiner oder größer ist als 50 m². Bei einer
Fläche zwischen 15 und 50 m² müssen die neuen
oder sanierten Außenbauteile des Anbaus oder
Umbaus die Altbau-Anforderungen der EnEV
erfüllen, wie sie in der Anlage 3 in der Tabelle
1 aufgeführt sind. Wenn die neu hinzugekommen
Nutzfläche jedoch größer als 50 m² ist, müssen
die Außenbauteile des Anbaus dermaßen geplant
werden, dass der neue Gebäudeteil die
Neubauanforderungen EnEV erfüllt. Das bedeutet,
dass sowohl der Jahres –Primärenergiebedarf als
auch der Wärmeverlust durch die Außenbauteile
die höchstzulässigen Werte nicht überschreiten
dürfen. In der Praxis
führt diese Regel häufig zu Schwierigkeiten,
denn bei der Nachweisführung wird mit der
bestehenden Heizung des Altbaus gerechnet und
die Anforderungen an den
Jahres-Primärenergiebedarf sind häufig nicht
wirtschaftlich zu erfüllen.
Deshalb schlagen die
beiden Ausschüsse vor, diese Nachweisführung
prinzipiell zu ändern. Als neues Kriterium solle
erstens gelten, ob anlässlich des Anbaus oder
Umbaus auch die Heizung erneuert wird. Wenn die
Heizung nicht erneuert wird sollten nur die
Wärmeschutz-Anforderungen der EnEV an die
Außenbauteile gelten, wie die Verordnung in der
Anlage 3 der EnEV 2009 bei
der Sanierung der Gebäudehülle fordert. Wenn ein
neuer Wärmeerzeuger eingebaut wird, solle der
neu hinzu gekommene Gebäudeteil nicht nur die
Neubau-Anforderungen sondern auch den
sommerlichen Wärmeschutz gewährleisten wie er in
der entsprechenden Anlage der EnEV geregelt
wird. Auf den ersten Blick ist dies ein sehr
guter Vorschlag und falls er vom
Bundesrats-Plenum unterstützt wird könnte es
sich für manchen Bauherrn lohnen einen geplanten
und aufgeschobenen Anbau oder Umbau doch noch
durchzuführen.

Bei Anbauten und
Umbauten alle betroffenen Außenbauteile sanieren
Hier empfehlen die
beiden Ausschüsse eine vom Bundeskabinett
vorgeschlagene Änderung der aktuellen EnEV 2009
wieder rückgängig zu machen. Es handelt sich um
die Außenbauteile, die einen neuen Anbau oder
Umbau umgeben. Bisher betrafen die Anforderungen
„die betroffenen Außenbauteile“ das bedeutet,
alle Außenbauteile die einen Anbau oder Umbau
umgeben. Dieses können durchaus auch Teile des
alten Gebäudes sein. Die Bundesregierung hatte
vorgeschlagen, die Anforderungen auf die
„Änderungen an den betroffenen Außenbauteilen“
zu begrenzen. Wenn also eine alte Außenwand den
Anbau oder Umbau direkt umgibt würden die EnEV-Anforderungen
nur gelten, wenn man diese auch
verändert. Die Bundesratsausschüsse wollen diese
Milderung der Anforderungen rückgängig machen
und durch den bisherigen Bezug auf die
„betroffenen Außenbauteile“ ersetzen.

Bei Nachrüstpflichten
der obersten Geschossdecke den Wärmeschutz nach
Baunorm berechnen
Gemäß aktueller
EnEV 2009, § 10 (Nachrüstung bei Anlagen und
Gebäuden) müssen Eigentümer die oberste
ungedämmte Geschossdecke über beheizte Räume
oder alternativ das darüber liegende Dach
gegebenenfalls dämmen. Damit dieser unbestimmte
Begriff „ungedämmte“ in der Praxis nicht weiter
für Verwirrung sorgt hat die länderübergreifende
Projektgruppe EnEV der Fachkommission
"Bautechnik" der Bauminister-Konferenz bereits
im Dezember 2009 in einer amtlichen Auslegung
eine Erklärung dafür veröffentlicht. Demnach
dient der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108
(Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden)
Teil 2 (Mindestanforderungen an den
Wärmeschutz), Ausgabe Juli 2003 als
Bemessungsgrenze.
Die
Bundestagsausschüsse empfehlen diese Methode
auch direkt in der EnEV-Novelle mit aufzunehmen.
Demnach müssten Eigentümer von Wohn- und
Nichtwohngebäuden die zugänglichen Decken ihrer
beheizten Räume zum unbeheizten Dachraum
(oberste Geschossdecken) bis Ende des Jahres
2015 dermaßen dämmen, dass deren
Wärmedurchgangskoeffizient höchstens 0,24
Watt/Quadratmeter und Kelvin (W/m² K) aufweist.
Also müssten oberste Geschossdecken, die den
Mindestwärmeschutz nach der oben angegebenen
Baunorm nicht erfüllen entweder selbst gedämmt
werden oder das darüber liegende Dach. Wenn es
nicht möglich sei den
Wärmedurchgangskoeffizienten der obersten
Geschossdecke zu berechnen, könnten Planer auch
auf veröffentlichte Bauteilkenngrößen für
Altbauten zurückgreifen. Wer die
Deckenzwischenräume oder Sparrenzwischenräume
des Daches dämmt solle künftig auch in den
Genuss des „Hohlraumprivilegs“ gelangen, der
bisher nur gilt, wenn die Bauteilzwischenräume
zu gering sind.

Erlaubte
Wärmeleitfähigkeit bei eingeblasenen Dämmschichten
erhöhen
Der
Kabinettsbeschluss für die EnEV-Novelle legt für
die Sanierung von Dächern sowie von Decken und
Wänden gegen unbeheizten Dachräume, für den Fall
einer technisch begrenzenden Schichtdicke
die höchstzulässige Wärmeleitfähigkeit generell
auf 0,035 W/mK fest. Eine Ausnahme erlaubt der
Entwurf des Bundeskabinetts und zwar wenn ein
Gebläsedämmung verwendet wird bei Decken gegen
unbeheizten Dachräume. Diese Bauteile dürften
beim Einblasen der Dämmschichten auch
weiterhin mit Materialien der
Wärmeleitfähigkeitsgruppen 045 energetisch
saniert werden.
Die Ausschüsse des Bundesrates fordern, dass diese Ausnahme nicht nur bei
Decken gegen unbeheizte Dachräume gilt sondern
dass auch Hohlräume in Dachkonstruktionen nach
diesen Bedingungen mit eingeblasen
Dämmschichten saniert werden könnten. Dieses würde auch
die Verwendung marktüblichen Naturdämmstoffe,
Holzfaserprodukte, Zellulose und Perlite
ermöglichen. Man könne demnach für alle
eingeblasenen Dämmungen die Wärmeleitfähigkeit
auf 0,045 W/(m K) begrenzen.

Niedrigeren
Wärmeschutz für Fenstertüren mit Klapp-, Falt-,
Schiebe oder Hebelmechanismus erlauben
Diese Fenstertüren
könnten konstruktionsbedingt und wegen dem
deutlich größeren Rahmenanteile im Vergleich zu
üblichen Fenstern die von der EnEV-Novelle
geforderten U-Werte nicht erreichen. Deshalb
fordern die Bundesratsausschüsse, dass bei
Sanierung im Bestand für erneuerte Fenstertüren
mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder
Hebelmechanismen der U-Wert auf 1,6
W/Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) erlaubt werde in Wohngebäuden und Zonen von
Nichtwohngebäuden mit Innentemperaturen von
mindestens 19 °C. Wenn die Innentemperaturen
zwischen 12-19 °C liege solle der U-Wert maximal
1,9 W/m²K erreichen dürfen. Würde jedoch ein
einzelner Flügelrahmen bzw. ein Flügel einer
bestehenden Fenstertür ersetzt, sollten
die Anforderungen wie bei Verglasungen gelten,
d.h. 1,1 W/m²K bei normalen Innentemperaturen
von mindestens 19°C und gar keine Anforderungen bei
Temperaturen zwischen 12 bis 19 °C.

ENERGIEAUSWEISE
Keine zusätzliche
Kontrollpflicht der Länder bei Neubauten
Der
Kabinettsentwurf für die EnEV-Novelle sieht
einen neuen § 26f (Stichprobenkontrollen bei der
Errichtung von Gebäuden) vor. Demnach müssten
die zuständigen Landesbehörden im
Stichproben-Verfahren kontrollieren, ob neu
errichtete Gebäude die Anforderung der EnEV für
Wohn- und Nichtwohnbauten erfüllen. Die
Bundesländer hätten dabei auch die Möglichkeit, dass
sie die Art der Überwachung selbst regeln und
zusätzliche Anforderungen stellen an die Art und
Weise wie die Daten erhoben, verarbeitet und
genutzt werden für die Vorbereitung und
Durchführung der Stichprobenkontrollen sowie für
eventuelle Bußgeldverfahren,
wenn die Anforderung nicht erfüllt würden.
Es überrascht
nicht, dass sich die Bundesratsausschüsse, in
denen die Vertreter der Länder zu Wort kommen,
gegen diese neue Pflicht aussprechen. Sie
schlagen vor, diesen neuen Paragraphen samt neuen Pflichten gänzlich zu
streichen. Sie begründen ihre Empfehlung damit,
dass diese zusätzlich Kontrolle weder der EU-Richtlinie 2010 entspreche
noch sei es erforderlich den Vollzug noch mehr
zu überprüfen. Der Entwurf des
Bundeskabinetts nenne weder etwaige
Vollzugsdefizite noch seien solche bekannt, die
eine zusätzliche Kontrolle erforderlich machten.
Es solle den Ländern selbst überlassen bleiben welche
Maßnahmen sie ergreifen um die
Neubau-Anforderungen der EnEV zu kontrollieren.
Außerdem würde sich diese zusätzliche Kontrolle
mit der vorgesehenen Prüfung der Energieausweise
überschneiden, die sich auch auf fertig
gestellte Neubauten beziehe.

In Immobilienanzeigen
die Energiekennwerte nicht auf die Wohnfläche
beziehen
Wie es die
EU-Gebäuderichtlinie 2010 fordert, sollen
künftig in kommerziellen Immobilienanzeigen auch
die Energiekennwerte der angebotenen Gebäude mit
veröffentlicht werden. Die Bundesregierung hat
in ihrem Kabinettsentwurf dafür einen neuen §
16a (Pflichtangaben in Immobilienanzeigen)
vorgesehen. Dabei schlägt sie vor, in den
Anzeigen den Endenergiebedarf bzw. -verbrauch
auf die Wohnfläche des Gebäudes zu beziehen,
obwohl die Kennwerte im Energieausweis gemäß der
Verordnung auf die Gebäudenutzfläche bezogen
berechnet werden.
Die Bundesratsausschüsse
lehnen diese zusätzliche Umrechnung auf die
Wohnfläche kategorisch ab. Sie gehen davon aus,
dass die gewünschte Transparenz darunter leiden
würde und es sicherlich zu Verwechslungen führen
würde, weil die sonstigen Energieausweise, die
bei Besichtigungen gezeigt werden, sich auch auf die
Gebäudenutzfläche beziehen. Wenn man diesen
zulässigen Wohnflächenbezug streicht
könnten auch die komplizierten
Übergangsregelungen entfallen.

KONTROLLE:
Registriernummer für
Energieausweise und Inspektionsberichte online
beantragen und Kontroll-Daten elektronisch übermitteln
Wie es die
EU-Gebäuderichtlinie 2010 fordert, wird auch
Deutschland ein unabhängiges, zentrales
Kontrollsystem einführen für die
Registriernummern für Energieausweise und
Inspektionsberichte für Klimaanlagen. Zu diesem
Zweck umfasst der Novellen-Entwurf des
Bundeskabinetts zwei neue Paragraphen: § 26c
(Registriernummer) und § 26d (Probenkontrollen
von Energieausweisen und Inspektionsberichten
über Klimaanlagen). Aussteller von
Energieausweisen und Inspektoren von
Klimaanlagen müssten demnach künftig zunächst
eine Registrierungsnummer zentral beantragen.
Der Entwurf des Bundeskabinetts lässt allerdings
offen auf welchem Weg diese Antragstellung
erfolgen soll.
Die Bundesratsausschüsse
empfehlen eine zusätzliche Regel mit aufzunehmen
sowohl für den Antrag auf eine
Registrierungsnummer als auch für die
Übermittlung der Daten für die stichprobenhafte Kontrolle
der Energieausweise und Inspektionsberichte für
Klimaanlagen durch die Baubehörden. Beides solle
künftig auf
elektronischen Weg (Internet und E-Mail)
erfolgen. Ausnahmsweise solle es auch möglich
sein, den Antrag und die Daten in Papierform
zu senden wenn es für den Antragsteller oder
Übermittler sonst zu einer unbilligen Härte
käme. Aus den Begründungen der
Ausschuss-Empfehlungen lässt sich schließen,
dass Aussteller von Energieausweisen und
Inspektoren von Klimaanlagen eine
Registrierungsnummer über ein Online-Formular
beantragen würden. Die Daten und Unterlagen für
die Kontrolle von Energieausweisen und
Inspektionsberichten würden sie per
E-Mail an die kontrollierende Baubehörde senden. Dafür würden sie die Unterlagen
einscannen. (Einen DIN A4 Flachbett-Scanner gibt
es heute übrigens bereits unter 100 Euro zu
kaufen.)
Die Ausschüsse stellen fest, dass
die elektronische Datenübermittlung den verpflichteten
Fachleuten grundsätzlich zumutbar sei, weil es
sich um berufsqualifizierte Architekten,
Ingenieure und Handwerksbetriebe handele, die in
ihrer Praxis üblicherweise auch Computer nutzen.
Wie gesagt, soll es auch Ausnahmen geben, wenn
die elektrische Datenübermittlung den
Verpflichteten wirtschaftlich persönlich nicht
zumutbar sei. Dann könnten sie die Kopien der
Dokumente auch in Papierform
der Behörde senden.

Bereits geprüfter
Energieausweise nicht nochmals prüfen
Wie es die
EU-Gebäuderichtlinie 2010 fordert sollen
Energieausweise künftig auch verstärkt kontrolliert
werden. Dafür sieht der Entwurf des
Bundeskabinetts vor, dass die Bundesländer
die Stichproben der Dokumente prüfen. Weil
jedoch etliche Länder bereits Energieausweise
kontrollieren, empfehlen die
Bundesratsausschüsse, dass in der EnEV-Novelle zusätzlich vermerkt wird,
dass ein bereits vom Land kontrollierter
Energieausweis nicht nochmals geprüft wird, falls
er für die neue stichprobenhafte Kontrolle
gezogen wird.

Kontrolldaten von
Energieausweisen zusätzlich auch zeitlich unbegrenzt
und nicht
personenbezogen auswerten
Die kürzlich
beschlossene Novelle des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG 2013) ermächtigt die
Bundesregierung unter anderem, dass sie in ihren
Rechtsverordnungen zur Energieeinsparung den
Ländern erlaubt die Daten, die sie für die
Kontrolle von Energieausweisen und
Inspektionsberichten für Klimaanlagen einsammelt
auch für weitere Zwecke nicht personenbezogen
auswerten.
Dazu empfehlen die
Bundesratsausschüsse einen neuen § 26d1 (Nicht
personenbezogene Auswertung von Daten)
einzufügen. Dieser solle auch regeln, auf welche
Merkmale sich die Auswertung beziehen darf.
Für
Energieausweise wäre es beispielsweise:
-
Art des Energieausweises (Energiebedarf oder
Energieverbrauch),
-
Anlass der Ausstellung (Neubau, Sanierung,
Verkauf, Neuvermietung oder öffentlicher
Aushang),
-
Art des Gebäudes (Wohn- oder Nichtwohnbau,
Neubau oder Bestand),
-
Gebäudeeigenschaften (Außenhülle,
Anlagentechnik, Warmwasserversorgung und bei
Nichtwohnbauten auch die Nutzungsart und
Zonierung),
-
Energiekennwerte (Höhe des End- und
Primärenergiebedarfs oder des End- und
Primärenergieverbrauchs),
-
Wichtigste Energieträger (Heizung,
Warmwasser),
-
Erneuerbarer Energien (Einsatz, Nutzung),
-
Gebäudestandort (Land und Landkreis, ohne den
Ort, die Straße und Hausnummer).
Bei der Kontrolle
der Inspektionsberichte über Klimaanlagen
könnten die Behörden insbesondere folgende
Merkmale anhand der eingereichten Daten
auswerten:
-
Nennleistung der Klimaanlage,
-
Gebäudeart (Wohn- oder Nichtwohnbau),
-
Gebäudestandort (Land und Landkreis, ohne den
Ort, die Straße und Hausnummer).

Die Bundesländer sollen erst ab
März 2017 über ihre Kontroll-Erfahrungen berichten
Der
Kabinettsentwurf für die EnEV-Novelle sieht
einen neuen § 26e (Erfahrungsberichte der
Länder) vor. Demnach sollten die Länder der
Bundesregierung erstmals am 1. März 2016 und
danach alle drei Jahre darüber berichten, welche
Erfahrungen sie mit den
Stichprobenprobenkontrollen für Energieausweise
und Inspektionsberichte über Klimaanlagen
gesammelt haben. Diese Berichte dürfen keinerlei
personenbezogene Daten enthalten.
Die
Bundesrats-Ausschüsse empfehlen für die
Plenarsitzung diese Pflicht erst ein Jahr
später, also ab dem 1. März 2017, einzuführen.

Es kommt ganz darauf an,
wann und was der Bundesrat im Plenum beschließt. Aus den
vergangenen Novellierungen erinnern wir uns, dass der
Bundesrat meistens die EnEV-Novelle mit gewissen
Maßgaben - d.h. zusätzlichen Änderungen - beschließt.
Diese werden an die Bundesregierung gesandt und diese
muss entscheiden ob sie die Maßgaben erfüllen oder das
Novellierungsverfahren nochmals aufrollen will.
Wenn die
Bundesregierung den Maßgaben des Bundesrates zustimmt,
muss die EnEV-Novelle noch redaktionell aufgearbeitet
werden und kann danach im Bundesgesetzblatt verkündet
werden samt dem Termin ab wann sie in Kraft tritt.
Höchstwahrscheinlich wird die EnEV-Novelle wieder als
Änderungsverordnung zur aktuellen EnEV 2009
veröffentlicht, d.h. nur die einzelnen Hinweise was sich
im Vergleich zur geltenden Verordnung ändert. In
EnEV-online werden Sie wieder den aktualisierten
Volltext der geänderten Verordnung finden und werden an
der roten Schriftfarbe erkenn, was sich letztendlich
geändert hat.
Üblicherweise vergehen von der Verkündung bis zum
Inkrafttreten einige Monate, so dass die Verpflichteten
sich auf die neuen Anforderungen einstellen und die Software-Anbieter ihre Produkte
rechtzeitig aktualisieren können.
Wir halten Sie auch
weiterhin auf dem Laufenden!

Autorin: Melita Tuschinski
Redaktion
EnEV-online.de
Quellen und weitere Informationen:
www.bundesrat.de | Drucksachen 113/13 und 113/1/13
 EnEV 2014: Kurzinfo für die Praxis Info-Broschüren (pdf)
EnEV 2014: Kurzinfo für die Praxis Info-Broschüren (pdf)

Folgende Nachrichten
könnten Sie auch interessieren:
EnEV 2014
verkündet: Neue Energieeinsparverordnung tritt ab 1. Mai 2014 in Kraft
(21.11.2013)
Umfrage-Ergebnis zum Energieausweis für Wohngebäude: EnEV 2014 führt Bandtacho
samt Effizienzklassen ein
(04.11.2013)
EnEV 2014 erhöht ab 2016 den Neubau-Standard:
Für welche Bauvorhaben gelten diese Regeln?
(02.11.2013)
EnEV 2014 voraussichtlich ab 1. Mai 2014 in Kraft: Änderungen im Vergleich zur EnEV 2009; welche Bauvorhaben die die neuen Anforderungen erfüllen
müssen
(26.10.2013)
EnEV 2014:
Aktueller Stand und weitere Schritte
(16.10.2013)
EnEV 2014: Irrtümer und Falschmeldungen zur EnEV-Novelle kurz aufgeklärt
(15.10.2013)
EnEV 2014: Aktueller Stand.
Welche Änderungen verlangt der Bundesrat? Wie geht es weiter mit der
EnEV-Novelle?
(15.10.2013)
Zankapfel Energieausweis für Wohnhäuser:
Bandtacho mit Effizienzklassen als Kompromiss?
Bundesrats-Ausschüsse schlagen eine praktische Mischung vor
(07.10.2013)
EnEV 2014 aktuell: Wann kommt die Novelle?
(23.09.2013)
Prüfsteine zur Bundestagswahl: Antworten der Parteien auf Fragen zur EnEV 2014,
Anforderungen im Bestand sowie Zusammenführung der EnEV und des EEWärmeG
(17.09.2013)
Auf dem Weg zur
EnEV 2014: Aktueller Stand, Tendenzen und Ausblick
(12.08.2013)
EnEV 2014:
Was wollen Auftraggeber wissen? Antworten auf die häufigsten Fragen
(12.08.2013)
Betrieb von elektrischen Speicherheizungen in bestimmten Bestandsgebäuden ab sofort wieder erlaubt: EnEG 2013 verändert aktuelle EnEV 2009
(15.07.2013)
EnEG 2013 verkündet: Gesetzliche Rahmenbedingungen für EnEV-Novelle geschaffen
und EnEV 2009 geändert
(17.07.2013)
Auf dem Weg zur EnEV 2014: Aktueller Stand, Tendenzen und Ausblick
(15.07.2013)
EnEV 2014 - Novelle im Bundesrat: Was empfehlen die Fachausschüsse?
(14.07.2013)
Übergang zur neuen EnEV-Fassung: Was sollten Fachleute, Bauherrn, Eigentümer und
Verwalter von bestehenden Gebäuden wissen?
(13.07.2013)
Bayern
sei Dank: EnEV-Novelle nun doch auf der Tagesordnung des
Bundesrat-Plenums am 5. Juli 2013. Was empfehlen die Fachausschüsse?
(03.07.2013)
EnEV 2014 auf dem Schleichweg ... Aktueller Stand der
Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) für
Gebäude
(25.06.2013)
EnEV 2014: Aushang-Energieausweis für Banken,
Kaufhäuser, Kinos, usw. ausstellen
(23.06.2013)
EnEG 2013 – geändertes Energieeinsparungsgesetz: Was
ändert sich im Vergleich zum geltenden EnEG 2009?
(21.06.2013)
Bundesrats-Ausschüsse befassen sich mit EnEV-Novelle:
Bayern will energetische Neubau-Verschärfung mindern
(17.06.2013)
Umweltausschuss im Bundesrat empfiehlt die vom Bundestag
verabschiedete EnEG-Novelle grundlegend zu ändern
(28.05.2013)
EnEG 2013: Vergleich der vom Bundestag beschlossenen Fassung mit dem Entwurf der Bundesregierung für die EnEG-Novelle
(17.05.2013)
EnEV-Novelle: Zurück auf LOS? Energiesparrecht im Umbruch:
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und Energieeinspar-Verordnung (EnEG) im
parlamentarischen Hürdenlaufe (14.05.2013)
Bauausschuss
im Bundestag verschiebt Debatte
über Energieeinsparnovelle (24.04.2013)
Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf für
die EnEG-Novelle (23.04.2013)
Bundesrat kritisiert EnEG-Entwurf der
Bundesregierung für die Novelle des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) (25.03.2013)
EnEG-Entwurf der Bundesregierung im Bundestag:
Zuständige Fachausschüsse befassen sich am 20. März
2013 mit der Novelle des Energieeinsparungsgesetzes
(EnEG) (16.03.2013)
Kritik am EnEG-Entwurf der Bundesregierung:
Fachausschüsse im Bundesrat empfehlen Änderungen des
Entwurfs für die Novelle des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) (12.03.2013)
EnEV 2014 – Kabinetts-Entwurf - Änderungen im
Vergleich zur EnEV 2009
(06.02.2013)
EnEG 2013 – Kabinetts-Entwurf - Änderungen im
Vergleich zum EnEG 2009
(06.02.2013)
Wie geht es weiter mit der EnEV-Novelle?
(18.01.2013)
Ab wann gelten die neuen EnEV-Anforderungen?
(28.01.2013)
Referentenentwurf für die EnEV- und EnEG-Novelle:
Die Meinungen der Betroffenen im Internet lesen
(20.12.2012)
EnEG 2013 – Novelle des Energieeinsparungsgesetzes
Referenten-Entwurf für EnEG-Novelle vom 15. Okt.
2012:
Was ändert sich im Vergleich zum geltenden EnEG
2009?
(15.10.2012)
Referenten-Entwurf für EnEV-Novelle vom 15. Okt.
2012: Was ändert sich im Vergleich zur geltenden
EnEV 2009?
(15.10.2012)
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden: EU-Kommission
fordert Italien auf die EU-Rechtsvorschriften
einzuhalten
(29.09.2011)
Zweiter Nationaler Energieeffizienz-Aktionsplan -
Bundesregierung berichtet der EU-Kommission
(31.08.2011)

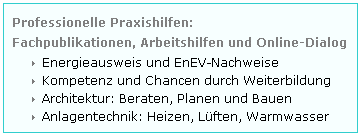
|