|
In diesem Beitrag
erfahren Sie wie die anstehende Novelle der
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sich im
Vergleich zur aktuell geltenden Verordnung EnEV 2009
gestalten könnte.
Überblick

Das Kabinett der
Bundesregierung hat in der Sitzung von Mittwoch, dem 6.
Februar 2013, auch den Entwurf für die Novelle der
Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Die
zuständigen Bundesministerien für Bau (BMVBS) und
Wirtschaft (BMWi) haben in einer Presseinfo darüber
berichtet.
Aktuell befasst sich der
Bundesrat mit der Novelle des EnEG. Hier haben die
Bundesländer Gelegenheit ihre Änderungswünsche und
Bedenken einzubringen, denn sie sind diejenigen, die
letztendlich die EnEV-Novelle umsetzen werden. Wir
berichten zum aktuellen Stand.

In EnEV-online finden Sie
auch eine
sehr ausführliche
Beschreibung des Referenten-Entwurfs für die
EnEV-Novelle. Diesen hatten die zuständigen
Bundesministerien für Bau (BMVBS), Wirtschaft (BMWi) und
Umwelt (BMU) Mitte Oktober 2012 den betroffenen
Wirtschaftskreisen, Länder und kommunalen
Spitzenverbänden zugesandt.
Wir werden in den folgenden Absätzen deshalb die
Änderungen, die der Referentenentwurf bereits brachte
nur kurz erwähnen und diejenigen Änderungen oder
Neuerungen, die der Kabinetts-Entwurf bringt
ausführlicher beschreiben.

Präambel aus Referentenentwurf in § 1 integriert
Der erste Paragraph der EnEV-Novelle erhält eine
ergänzte Bezeichnung. Anstatt „Anwendungsbereich“ heißt
er nun gemäß dem Kabinetts-Entwurf „Zweck und
Anwendungsbereich“. Was der Referenten-Entwurf der
EnEV-Novelle als Präambel vorangestellt hatte erscheint
nun als erster Absatz im § 1 (Zweck und
Anwendungsbereich) wie folgt:
„Zweck dieser Verordnung ist die Einsparung von Energie
in Gebäuden. In diesem Rahmen und unter Beachtung des
gesetzlichen Grundsatzes der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit soll die Verordnung dazu beitragen, dass
die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung,
insbesondere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand
bis zum Jahr 2050, erreicht werden. Neben den
Festlegungen in der Verordnung soll dieses Ziel auch mit
anderen Instrumenten, insbesondere mit einer
Modernisierungsoffensive für Gebäude, Anreizen durch die
Förderpolitik und einem Sanierungsfahrplan, verfolgt
werden.“
Definition für Ferienhäuser verändert
Wie im Referentenentwurf sollen Wohnhäuser mit einer
begrenzten Nutzungsdauer nicht nur nach der Dauer ihrer
Nutzung – unter vier Monaten jährlich – sondern auch
anhand des zu erwarteten Energieverbrauchs bei
volljährigen Nutzung definiert werden. Dieser Ansatz
entstammt dem Referenten-Entwurf.
Definition für Nutzflächen mit starkem Publikumsverkehr
Auch diese Ergänzung aus dem Referenten-Entwurf hat das
Bundeskabinett unverändert übernommen. Im § 2
(Begriffsbestimmungen) werden sie definiert, damit die
Eigentümer wissen, ob sie in ihrem vielbesuchten Gebäude
ggf. künftig auch einen Energieausweis aushängen müssen.

EnEV-easy Methode wird aus der EnEV ausgelagert
Der Referentenentwurf führte im § (Anforderungen an
Wohngebäude) einen neuen letzten Absatz 5 ein mit der
vereinfachten Nachweis-Methode für Bestimmte Wohngebäude
– bekannt durch das Stuttgarter Projekt „EnEV-easy“. Der Entwurf
verwies dabei auf die zahlreichen und umfangreichen
Tabellen in Anlage 1 (Anforderungen an Wohngebäude).
Der Kabinetts-Entwurf lagert diese Methodik aus in der
Art und Weise wie die bisherigen Bekanntmachungen der
zuständigen Bundesministerien die Datenerfassung und
Energie-Berechnung für Energieausweise im Bestand
unterstützen. Damit wird die EnEV-Novelle erheblich
„schlanker“, was sicherlich alle begrüßen.
So lautet der
neue Absatz 5 im § 3 (Anforderungen an Wohngebäude) nun
wie folgt:
„Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für
Gruppen von nicht gekühlten Wohngebäuden auf der
Grundlage von Modellberechnungen bestimmte
Ausstattungsvarianten beschreiben, die unter dort
definierten Anwendungsvoraussetzungen die Anforderungen
nach den Absätzen 1, 2 und 4 generell erfüllen, und
diese im Bundesanzeiger bekannt machen. Die
Anwendungsvoraussetzungen können sich auf die Größe, die
Form, die Ausrichtung und die Dichtheit der Gebäude
sowie auf die Vermeidung von Wärmebrücken und auf die
Anteile von bestimmten Außenbauteilen an der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche beziehen. Die
Einhaltung der in den Absätzen 1, 2 und 4 festgelegten
Anforderungen wird vermutet, wenn ein nicht gekühltes
Wohngebäude die Anwendungsvoraussetzungen erfüllt, die
in der Bekanntmachung definiert sind, und gemäß einer
der dazu beschriebenen Ausstattungsvarianten errichtet
wird; Berechnungen nach Absatz 3 sind nicht
erforderlich.“

Strom aus erneuerbaren Energien anrechnen
Der Entwurf des Bundeskabinetts formuliert die
Anforderung im § 5 (Anrechnung von Strom aus
erneuerbaren Energien) um und trägt damit zur
Verständlichkeit bei. Demnach erlaubt die EnEV-Novelle,
wenn man Strom aus erneuerbaren Energien nutzt diesen
vom berechneten Endenergiebedarf abzieht, wenn dieser „…
vorrangig in dem Gebäude unmittelbar nach Erzeugung oder
nach vorübergehender Speicherung selbst genutzt und nur
die überschüssige Energiemenge in ein öffentliches Netz
eingespeist wird.“ Die verwendeten Berechnungsmethoden
sind im zweiten Absatz dieses Paragraphen wie im
Referentenentwurf belassen.
Energierelevante Änderungen der Gebäudehüllen
Nachdem bereits der Referentenentwurf den ersten Absatz
des § 9 (Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden)
weit verständlicher umformuliert hatte bringt der
Kabinetts-Entwurf erfreulicherweise einen noch klareren
Text:
„Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen von Gebäuden
Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6
ausgeführt werden, sind die Änderungen so auszuführen,
dass die Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen
Flächen die für solche Außenbauteile in Anlage 3
festgelegten Höchstwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten nicht überschreiten.“
Wir
hoffen, dass diese Klarstellung die Missverständnisse zu
diesem Thema nochmals reduziert.
Nach wie vor gilt
auch die 140-Prozent-Regel. Sie besagt, dass bei
geänderter Gebäudehülle der EnEV-Nachweis auch
gilt, wenn der Plane rechnerisch nachweist, dass
das gesamte geänderte Bestandsgebäude höchstens
40 Prozent energetisch schlechter abschneidet
als ein Referenzgebäude nach EnEV, welches bei
Neubauten als Maßstab gilt. Die entsprechenden
baulichen und technischen Ausstattungen regelt
die EnEV in den Anlagen 1 (Wohnbau) sowie Anlage
2 (Nichtwohnbau). Allerdings gelten die
Standard-Verschärfungen - die in den Tabellen ab
1. Januar 2016 angegeben sind - in den
140-Prozent-Nachweis-Fällen nicht.
Anbau, Ausbau und
Umbau im Bestand
Wer nach EnEV 2009
die beheizte oder gekühlte Flächen in einem
bestehenden Gebäude erweitert - sei es durch
einen Anbau, eine Aufstockung, Ausbau oder Umbau
- m
Neue Bagatellregel für geänderte Außenbauteile im
Bestand
Im Referenten-Entwurf war die Anforderung der EnEV 2009
zur Aufrechterhaltung der energetischen Qualität, gemäß
§ 11 unverändert übernommen. Der Kabinetts-Entwurf
bringt eine Neuerung, indem er erlaubt bei
kleinflächigen Änderungen der Gebäudehülle den ersten
Satz dieses Paragraphen zu missachten:
„Außenbauteile dürfen nicht in einer Weise verändert
werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes
verschlechtert wird. … Satz 1 ist nicht anzuwenden auf
Änderungen von Außenbauteilen, wenn die Fläche der
geänderten Bauteile nicht mehr als 10 Prozent der
gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes
betrifft.“

Energetische Inspektion von Klimaanlagen
Weil die Inspektionsberichte laut EU-Richtlinie auch in
das zentrale, unabhängige nationale Kontrollsystem
erfasst werden sollen hat auch der Entwurf des
Bundeskabinetts den neuen Absatz 5 des Paragraphen 12
(Energetische Inspektion von Klimaanlagen) übernommen.
Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
Im § 14 hatte der Referentenentwurf Fußbodenheizungen in
Räumen unter sechs Quadratmeter von der Pflicht
verschont in jedem Raum eine Regelung einbauen zu
müssen. Der Kabinetts-Entwurf hat diese Lockerung der
Regeln übernommen.
Geblieben ist auch die Forderung des
Referentenentwurfs: „Fußbodenheizungen, die vor dem 1.
Februar 2002 eingebaut worden sind, dürfen abweichend
von Satz 1 erster Halbsatz mit Einrichtungen zur
raumweisen Anpassung der Wärmeleistung an die Heizlast
ausgestattet werden.“ Folgende Anforderung soll demnach
für diese älteren Fußbodenheizungen nicht gelten:
„Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger
müssen beim Einbau in Gebäude mit selbsttätig wirkenden
Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur
ausgestattet werden.“

Energieausweis für Bestandbauten
Die Anforderungen an den Energieausweis, wie sie der
Referentenentwurf im § 16 (Ausstellung und Verwendung
von Energieausweisen) vorgeschlagen hat, hat der
Kabinetts-Entwurf vollständig übernommen. Kurz gefasst
handelt es sich um folgende Anforderungen:
-
Bei Neubauten muss der Bauherr als Eigentümer dafür
sorgen, dass man ihm einen Energieausweis – unverzüglich
nachdem das Gebäude fertig erbaut ist – ausstellt und
zwar aufgrund des fertig erbauten Gebäudes - und dass
man ihm den Energieausweis oder eine Kopie davon
übergibt.
-
Dieses gilt auch für diejenigen Fälle, dass für ein
Bestandsgebäude im Zuge der Sanierung eine Berechnung
aufgrund des gesamten Gebäudes durchgeführt wurde.
-
Bei Verkauf oder Neuvermietung im Bestand muss der
Verkäufer, bzw. Vermieter seinen potenziellen Kunden den
Energieausweis spätestens bei der Besichtigung vorlegen
oder gut sichtbar aushängen.
-
Wenn keine Besichtigung stattfindet muss der Verkäufer
oder Vermieter den Energieausweis oder eine Kopie davon
seinen potenziellen Kunden spätestens unverzüglich
vorlegen, wenn diese ihn verlangen.
-
Wenn ein Kauf- oder neuer Mietvertrag zustande kommt
muss der Verkäufer bzw. Vermieter danach dem Käufer bzw.
dem Mieter den Energieausweis oder eine Kopie davon
unverzüglich übergeben.
-
Die Aushangs-Pflicht für Energieausweise wird
erheblich erweitert: Bei über 500 Quadratmeter (m²)
Nutzfläche – und ab 8. Juli 2015 ab 250 m³ - müssen die
Eigentümer von behördlich genutzte Gebäude einen
Energieausweis aushängen. Auch privatwirtschaftlich
genutzte Gebäuden mit über 500 m² Nutzfläche mit regem
Publikumsverkehr müssen künftig einen Energieausweis
aushängen: Ladengeschäfte, Einkaufszentren,
Supermärkte, Vergnügungsstätten, Hotels,
Banken, Gaststätten, Diskotheken,
Krankenhäuser, Ärztehäuser,
Dienstleistungseinrichtungen,
Sporteinrichtungen, Theater, Opern,
Bibliotheken, Schwimmbäder, Turnhallen,
Schulen, Kindertagesstätten, Einrichtungen
des öffentlichen Personennah- und
-fernverkehrs, öffentliche Verwaltungen,
Gerichte, Museen, Galerien, usw. Wenn der Eigentümer das Gebäude nicht
überwiegend selbst nutzt muss er den Energieausweis dem
Mieter übergeben, damit dieser ihn aushängt.
-
Eine Änderung betrifft den Bedarfs-Energieausweis im
Bestand. Diese ist jedoch im § 18 (Ausstellung auf der
Grundlage des Energiebedarfs) geregelt. Demnach müssen
Aussteller, die die vereinfachte Rechenmethode für
Wohnhäuser genutzt haben – „EnEV-easy“ – die Kennwerte
angeben, die für die entsprechende Ausstattungsvariante
in den Bekanntmachungen der Bundesministerien
veröffentlicht sind.

Energieangaben in Immobilienanzeigen
Den neuen § 16a (Pflichtangaben in Immobilienanzeigen)
aus dem Referenten-Entwurf hat der Kabinetts-Entwurf
unverändert übernommen. Hier die Anforderungen kurz
zusammengefasst:
Wer eine Anzeige in einem kommerziellen Medium schaltet
und wenn bereits ein Energieausweis ausgestellt wurde
muss folgende Energiekennwerte mit angeben:
-
Art des ausgestellte Energieausweises (Energiebedarf
oder -verbrauch),
-
Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauchs für
Gebäude,
-
wesentliche Energieträger für die Heizung des
Gebäudes.
Für Wohngebäude bringt der Entwurf eine besondere
Regelung: Der Endenergiebedarf oder -verbrauch muss auf
die Wohnfläche bezogen sein. Wenn die Wohnfläche nicht
bekannt ist, bietet der Entwurf eine vereinfachte
Berechnung an. Bei Nichtwohngebäuden sollen die
Energiekennwerte in kommerziellen Anzeigen sowohl für
Wärme als auch für Strom getrennt aufgeführt sein.
Grundsätze des Energieausweises
Die Änderungen aus dem Referentenentwurf hat der
Kabinetts-Beschluss vollständig übernommen. Was sich
ändert ist die Tatsache, dass die
Modernisierungsempfehlungen nicht mehr dem
Energieausweis beiliegen sondern integriert sind.
Die zweite Änderung bezieht sich auf die
Registriernummer, welcher der Aussteller nach den neuen
Regeln beantragen muss. Bis er die Registriernummer
erhält muss er im Energieausweis vermerken, dass er
diese beantragt hat und nachdem er sie erhalten hat dem
Energieausweis beifügen und dem Auftraggeber den
kompletten Energieausweis übergeben.

Modernisierungsempfehlungen als Teil des
Energieausweises
In ihren Anlagen stellt die EnEV 2009 auch Muster für
die Darstellung des Energieausweises jeweils gesondert
für Wohn- und Nichtwohngebäude - bereit. Für die
Modernisierungsempfehlungen muss der Aussteller
allerdings soweit die Anlage 10 (Muster
Modernisierungsempfehlungen) nutzen und sie dem
Energieausweis beilegen. Der Referentenentwurf und auch
der Kabinetts-Beschluss integrieren dieses Muster in die
Energieausweise für Wohn- und Nichtwohnbauten jeweils
als vorletzte Seite. Auf der letzten Seite des
Energieausweises sind die Erläuterungen abgedruckt.
Diese sind in den Entwürfen für die EnEV-Novelle auch
viel ausführlicher gestaltet als in der
EnEV-2009-Version um Missverständnisse auszuschließen.
Neues, unabhängigen Kontrollsystem
Wie es die EU-Gebäuderichtlinie 2010 fordert, führt die
EnEV-Novelle ein neues System ein welches den Behörden
erlauben soll Stichproben von Energieausweisen oder
Inspektionsberichten für Klimaanlagen auszuwählen und
anhand der Unterlagen zu kontrollieren. Dafür haben
sowohl Referentenentwurf als auch der Kabinetts-Entwurf
zwei neue Paragraphen vorgeschlagen:
- § 26c Registriernummern
- § 26d Stichprobenkontrollen.
Auf die neue, zentrale Online-Datenbank mit den
Registriernummern für alle ausgestellten Energieausweise
und Inspektionsberichte für Klimaanlagen sollen die
Baubehörden in den Ländern jeweils zugreifen und
Stichprobenkontrollen durchführen können. Aussteller von
Energieausweisen und Inspekteure für Klimaanlagen werden
künftig bei der zuständigen Behörde eine
Registriernummer beantragen. Dabei müssen sie ihren
Namen und Anschrift, das Bundesland und die Postleitzahl
des betroffenen Gebäudes angeben sowie das
Ausstellungsdatum des Berichtes oder des
Gebäude-Ausweises. Die Inspekteure müssen zusätzlich
noch die Nennleistung der inspizierten Klimaanlage
ausweisen. Bei Energieausweisen müssen auch die Art der
Berechnung (Energiebedarf oder -verbrauch) und des
Gebäudes (Wohn- oder Nichtwohnbau) mit angegeben sein.
Bis zu sieben – nicht drei Jahre nach dem Inkrafttreten
der EnEV-Novelle wie der Referentenentwurf vorsah – soll
nach dem Beschluss der Bundeskabinetts das Deutsche
Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin die Aufgaben
einer bundesweiten Registrierstelle für
Inspektionsberichte und Energieausweise übernehmen, bis
die Länder ihre eigenen Regelungen treffen. Dieses
regelt der neue § 30 (Übergangsvorschrift über die
vorläufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben der Länder
durch das Deutsche Institut für Bautechnik). Neu
hinzugekommen ist die Einschränkung durch den
Kabinetts-Beschluss, dass das DIBt nur solche
Ausgaben übernimmt, die elektronisch
durchgeführt werden.
Anhand der einzelnen Registriernummer sollen die
Baubehörden künftig Berichte und Energieausweise
Stichproben auswählen und anhand der angeforderten
Unterlagen kontrollieren ob die EnEV-Vorgaben erfüllt
sind.
Wie das in der Praxis aussehen soll regelt der
Kabinetts-Entwurf wie der Referentenentwurf wie folgt.
Die Behörden müssen demnach entweder:
-
untersuchen wie glaubwürdig die Eingaben und
Ergebnisse im Energieausweis sind (Validität),
-
die Eingaben, Ausgaben und Modernisierungsempfehlungen
prüfen,
-
eine vollständige Prüfung der Berechnungen im
Energieausweis durchführen und sogar das betreffende
Haus besichtigen - Letzteres allerdings nur wenn der Eigentümer damit einverstanden
ist.
Ordnungswidrigkeiten wurden erweitert
Wer seine Pflichten zur Vorlage und Übergabe des
Energieausweises verletzt oder in kommerziellen Anzeigen
die Energiekennwerte des Gebäudes nicht angibt soll nach
den Entwürfen für die EnEV-Novelle ordnungswidrig
handelt und es drohen ihm (theoretisch) Bußgelder. Deren
Höhe erstreckt sich – je nach Vergehen - nach wie vor
zwischen 5.000 und 50.000 Euro.

Energiestandard für Wohngebäude moderat erhöht
Wie aus dem Referentenentwurf bekannt, erhöht der
Kabinetts-Beschluss den Energiestandard bei Wohngebäuden
in zwei Stufen – mit Inkrafttreten voraussichtlich ab
2014 sowie zusätzlich ab 2016 – anhand folgender
Energie-Kennwerte:
- Jahres-Primärenergiebedarf sinkt um
je 12,5
Prozent (%)
- Wärmeschutz der Gebäudehülle sinkt um jeweils 10 %.
Dementsprechend umfasst auch der Entwurf des
Bundeskabinetts etliche Änderungen in der Anlage 1
(Anforderungen an Wohngebäude) wobei diese sich auf
Neubauten (zu § 3 Wohngebäude und § 4 Nichtwohnbauten)
und auf bestimmte Änderungen im Bestand (zu § 9
Änderungen der Gebäudehülle, Anbauten, Ausbauten und
Umbauten) beziehen.
-
Jahres-Primärenergiebedarf
Die genannte Verschärfung des
Jahres-Primärenergiebedarfs in zwei Stufen bringen beide
Entwürfe in der Tabelle 1 (Ausführung des
Referenzgebäudes) in der ersten Zeile.
Demnach müssen Planer für die Berechnung des maximal
erlaubten Jahres-Primärenergiebedarfs, den sie anhand
des Referenzgebäudes berechnen mit einem Faktor
multiplizieren:
- ab Inkrafttreten der EnEV-Novelle mit 0,875,
- für Neubau-Vorhaben ab 2016 mit 0,750.
-
Wärmeschutz der Gebäudehülle
Der Kabinetts-Beschluss regelt die stufenweise
Verschärfung der Wärmeschutz-Anforderungen an die
Gebäudehülle einfacher und übersichtlicher als der
Referentenentwurf.
In der Anlage 2 unter Nr. 1.2.
(Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust)
lautet die neue Regel wie folgt:
„Der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust
eines zu errichtenden Wohngebäudes darf das 1,1fache des
entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebäudes
nicht überschreiten. Ab dem 1. Januar 2016 darf der
spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogene Transmissionswärmeverlust eines zu errichtenden
Wohngebäudes das 1,0fache des entsprechenden Wertes des
jeweiligen Referenzgebäudes nicht überschreiten. Die
jeweiligen Höchstwerte der Tabelle 2 dürfen dabei nicht
überschritten werden.“
Mit anderen Worten: Den maximalen, spezifischen, auf die
wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene
Transmissionswärmeverlust eines neuen Wohngebäudes
müssen Planer anhand des Wertes des jeweiligen
Referenzgebäudes berechnen, indem sie ihn mit einem
Faktor multiplizieren:
- ab Inkrafttreten der EnEV-Novelle mit 1,1
- für Neubau-Vorhaben ab 2016 mit 1,0.
Dabei darf er auch er auch die Werte in Tabelle 2
(Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts)
nicht überschreiten. Diese Tabelle hat der
Kabinetts-Beschluss nun unverändert von der EnEV 2009
übernommen, mit den bereits bekannten Werten.
Als einzige Änderung erläutert der Kabinetts-Beschluss
zusätzlich was man unter „einseitig angebauten
Wohnhäusern“ zu verstehen hat: „Einseitig angebaut ist
ein Wohngebäude, wenn von den vertikalen Flächen dieses
Gebäudes, die nach einer Himmelsrichtung weisen, ein
Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes
Wohngebäude oder an ein Nichtwohngebäude mit einer
Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius
angrenzt.“

Aktuell befasst sich der Bundesrat mit der Novelle der
EnEV. Hier haben die Bundesländer Gelegenheit ihre
Änderungswünsche und Bedenken einzubringen, denn sie
sind diejenigen, die letztendlich die EnEV-Novelle in
die Praxis umsetzen werden.
-
Empfehlungen der
Bundesrats-Fachausschüsse
Im Bundesrat befassen sich zunächst die relevanten,
fachlichen Ausschüsse mit dem Novellen-Entwurf. Für die
EnEV sind es insgesamt die viert folgende Ausschüsse:
• Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung (Wo) -
federführender Ausschuss,
• Finanzen (Fz)
• Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (U),
• Wirtschaft (Wi).
Auf den Webseiten des Bundesrates finden Interessierte
unter der Rubrik „Organe und Mitglieder“ die Übersicht
der Fachausschüsse sowie zu jedem einzelnen Ausschuss
auch Informationen zu den Vorsitzenden und Mitgliedern,
die Sitzungstermine mit den Tagungsordnungen sowie die
Kontaktdaten zum Ausschussbüro. Die Sitzungen der
Ausschüsse sind nicht öffentlich, im Internet findet man
die Tagungsordnung und Dokumente.
Am 7. März 2013 wird sich der Wohnungsausschuss auch mit
dem Entwurf für die EnEV-Novelle befassen. Die
Mitglieder des Ausschusses werden die Eingaben der
Bundesländer besprechen und werden eine Empfehlung an
das Plenum des Bundesrates verfassen in dem sie
verschiedene Änderungen befürworten und vielleicht sogar
neue Änderungen empfehlen.
-
Bundesrats-Plenum stimmt
über EnEV-Novelle ab
Als nächsten Schritt soll sich das Plenum des
Bundesrates mit dem Entwurf für die EnEV-Novelle
befassen. Der Termin steht noch nicht fest. Es gibt
keine „festgezurrte“ Frist wie für die EnEG-Novelle.
Wenn der Bundesrat im Plenum mit Maßgaben zustimmt, d.h.
noch einige Änderungen verbindlich festlegt, muss das
Bundeskabinett zunächst über diese beschließen, bevor
die EnEV-Novelle weiterhin den vorgegebenen
parlamentarischen Lauf nehmen kann.
www.bundesrat.de
Drucksache Nr. 113/13 vom
08.02.2013

-
Bundestag befasst sich mit EnEV-Novelle
Als nächsten Schritt wird sich der Bundestag mit dem
Entwurf für die EnEV-Novelle befassen. Wir werden in
EnEV-online auch darüber berichten.
-
EnEV-Novelle wird verkündet
Wie üblich, wird auch die EnEV-Novelle im
Bundesgesetzblatt verkündet werden, im Bundesanzeiger
Verlag mit Sitz in Köln. Der amtlich gültige
Gesetzestext wird demnach als Zweite Änderungsverordnung
zur Energieeinsparverordnung veröffentlicht. Das
bedeutet, dass nur die die einzelnen Änderungen im
Vergleich zur aktuellen EnEV veröffentlicht werden.
Damit Sie den geänderten Verordnungstext lesen und die
Änderungen nachvollziehen können werden wir die EnEV
2014 als Html-Text in EnEV-online veröffentlichen und
die Änderungen in roter Schriftfarbe kenntlich machen.
| www.bundesgesetzblatt.de

Im Artikel 3 des Kabinetts-Entwurf überraschen völlig
andere Zeitfristen für das Inkrafttreten der Novelle als
im Referentenentwurf. Zwar schlägt auch der Entwurf des
Bundeskabinetts zwei Stufen vor, doch diese gestalten
sich folgendermaßen:
Nach ca. sechs Monaten – d. h. am ersten Tag des
sechsten Monats nach der Verkündung der Verordnung –
tritt die EnEV-Novelle in Kraft außer einer bestimmten
neugefassten Anforderung im § 27 (Ordnungswidrigkeiten).
Damit die EnEV-Novelle ab 1. Januar 2014 in
Kraft tritt müsste sie demnach - gemäß dem
Kabinetts-Beschluss - im Juli 2013 verkündet
werden, was wohl sehr kurzfristig scheint
angesichts unserer bisherigen Erfahrung mit
EnEV-Novellierungen.
Die zweite Stufe
der EnEV-Novelle soll erst ca. ein Jahr nach dem Inkrafttreten gelten - d. h. am ersten Tag des 18. Monats
nach der Verkündung der Verordnung. Es handelt sich um
die Pflicht in Immobilienanzeigen die Energiekennwerte
von Gebäuden auch mit anzugeben: „Ordnungswidrig …
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig … nicht
sicherstellt, dass in der Immobilienanzeige die
Pflichtangaben enthalten sind.“ Man kann also davon
ausgehen, dass bei der Anhörung der interessierten
Kreise dieser Aufschub sehr dringend und überzeugend
gefordert wurde.

Autorin: Melita Tuschinski
Redaktion
EnEV-online.de
 EnEV 2014: Kurzinfo für die Praxis Info-Broschüren (pdf)
EnEV 2014: Kurzinfo für die Praxis Info-Broschüren (pdf)

Folgende Nachrichten
könnten Sie auch interessieren:
EnEV 2014
verkündet: Neue Energieeinsparverordnung tritt ab 1. Mai 2014 in Kraft
(21.11.2013)
Umfrage-Ergebnis zum Energieausweis für Wohngebäude: EnEV 2014 führt Bandtacho
samt Effizienzklassen ein
(04.11.2013)
EnEV 2014 erhöht ab 2016 den Neubau-Standard:
Für welche Bauvorhaben gelten diese Regeln?
(02.11.2013)
EnEV 2014 voraussichtlich ab 1. Mai 2014 in Kraft: Änderungen im Vergleich zur EnEV 2009; welche Bauvorhaben die die neuen Anforderungen erfüllen
müssen
(26.10.2013)
EnEV 2014:
Aktueller Stand und weitere Schritte
(16.10.2013)
EnEV 2014: Irrtümer und Falschmeldungen zur EnEV-Novelle kurz aufgeklärt
(15.10.2013)
EnEV 2014: Aktueller Stand.
Welche Änderungen verlangt der Bundesrat? Wie geht es weiter mit der
EnEV-Novelle?
(15.10.2013)
Zankapfel Energieausweis für Wohnhäuser:
Bandtacho mit Effizienzklassen als Kompromiss?
Bundesrats-Ausschüsse schlagen eine praktische Mischung vor
(07.10.2013)
EnEV 2014 aktuell: Wann kommt die Novelle?
(23.09.2013)
Prüfsteine zur Bundestagswahl: Antworten der Parteien auf Fragen zur EnEV 2014,
Anforderungen im Bestand sowie Zusammenführung der EnEV und des EEWärmeG
(17.09.2013)
Auf dem Weg zur
EnEV 2014: Aktueller Stand, Tendenzen und Ausblick
(12.08.2013)
EnEV 2014:
Was wollen Auftraggeber wissen? Antworten auf die häufigsten Fragen
(12.08.2013)
Betrieb von elektrischen Speicherheizungen in bestimmten Bestandsgebäuden ab sofort wieder erlaubt: EnEG 2013 verändert aktuelle EnEV 2009
(15.07.2013)
EnEG 2013 verkündet: Gesetzliche Rahmenbedingungen für EnEV-Novelle geschaffen
und EnEV 2009 geändert
(17.07.2013)
Auf dem Weg zur EnEV 2014: Aktueller Stand, Tendenzen und Ausblick
(15.07.2013)
EnEV 2014 - Novelle im Bundesrat: Was empfehlen die Fachausschüsse?
(14.07.2013)
Übergang zur neuen EnEV-Fassung: Was sollten Fachleute, Bauherrn, Eigentümer und
Verwalter von bestehenden Gebäuden wissen?
(13.07.2013)
Bayern
sei Dank: EnEV-Novelle nun doch auf der Tagesordnung des
Bundesrat-Plenums am 5. Juli 2013. Was empfehlen die Fachausschüsse?
(03.07.2013)
EnEV 2014 auf dem Schleichweg ... Aktueller Stand der
Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) für
Gebäude
(25.06.2013)
EnEV 2014: Aushang-Energieausweis für Banken,
Kaufhäuser, Kinos, usw. ausstellen
(23.06.2013)
EnEG 2013 – geändertes Energieeinsparungsgesetz: Was
ändert sich im Vergleich zum geltenden EnEG 2009?
(21.06.2013)
Bundesrats-Ausschüsse befassen sich mit
EnEV-Novelle: Bayern will energetische
Neubau-Verschärfung mindern
(17.06.2013)
Umweltausschuss im Bundesrat empfiehlt die vom
Bundestag verabschiedete EnEG-Novelle
grundlegend zu ändern
(28.05.2013)
EnEG 2013: Vergleich der vom Bundestag beschlossenen Fassung mit dem Entwurf der Bundesregierung für die EnEG-Novelle
(17.05.2013)
EnEV-Novelle: Zurück auf LOS? Energiesparrecht im Umbruch:
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und Energieeinspar-Verordnung (EnEG) im
parlamentarischen Hürdenlaufe (14.05.2013)
Bauausschuss
im Bundestag verschiebt Debatte
über Energieeinsparnovelle (24.04.2013)
Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf für
die EnEG-Novelle (23.04.2013)
Bundesrat
kritisiert EnEG-Entwurf der Bundesregierung für die Novelle des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) (25.03.2013)
EnEG-Entwurf der Bundesregierung im Bundestag:
Zuständige Fachausschüsse befassen sich am 20. März
2013 mit der Novelle des Energieeinsparungsgesetzes
(EnEG) (16.03.2013)
Kritik am EnEG-Entwurf der Bundesregierung:
Fachausschüsse im Bundesrat empfehlen Änderungen des
Entwurfs für die Novelle des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) (12.03.2013)
EnEG 2013 – Kabinetts-Entwurf - Änderungen im
Vergleich zum EnEG 2009
(06.02.2013)
Wie geht es weiter mit der EnEV-Novelle?
(18.01.2013)
Ab wann gelten die neuen EnEV-Anforderungen?
(28.01.2013)
Referentenentwurf für die EnEV- und EnEG-Novelle:
Die Meinungen der Betroffenen im Internet lesen
(20.12.2012)
EnEG 2013 – Novelle des Energieeinsparungsgesetzes
Referenten-Entwurf für EnEG-Novelle vom 15. Okt.
2012:
Was ändert sich im Vergleich zum geltenden EnEG
2009?
(15.10.2012)
Referenten-Entwurf für EnEV-Novelle vom 15. Okt.
2012: Was ändert sich im Vergleich zur geltenden
EnEV 2009?
(15.10.2012)
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden: EU-Kommission
fordert Italien auf die EU-Rechtsvorschriften
einzuhalten
(29.09.2011)
Zweiter Nationaler Energieeffizienz-Aktionsplan -
Bundesregierung berichtet der EU-Kommission
(31.08.2011)

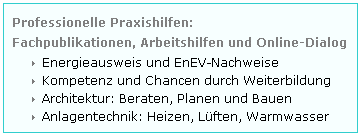
|